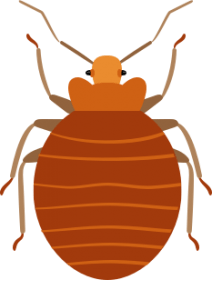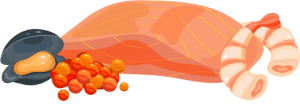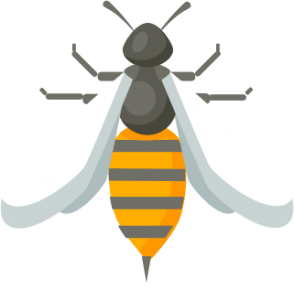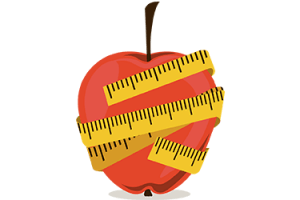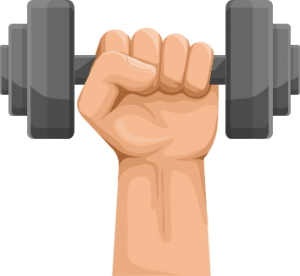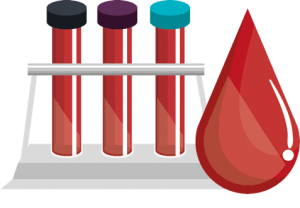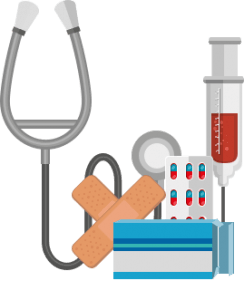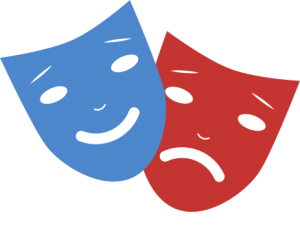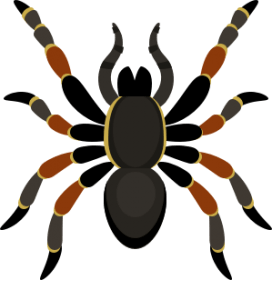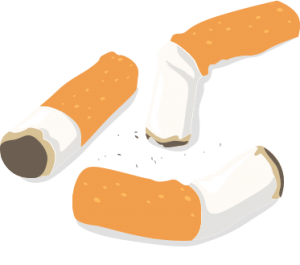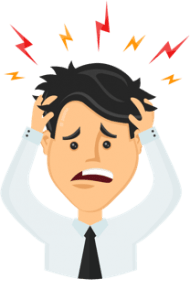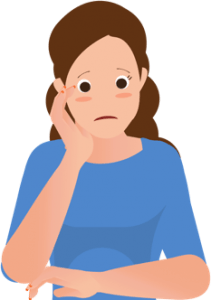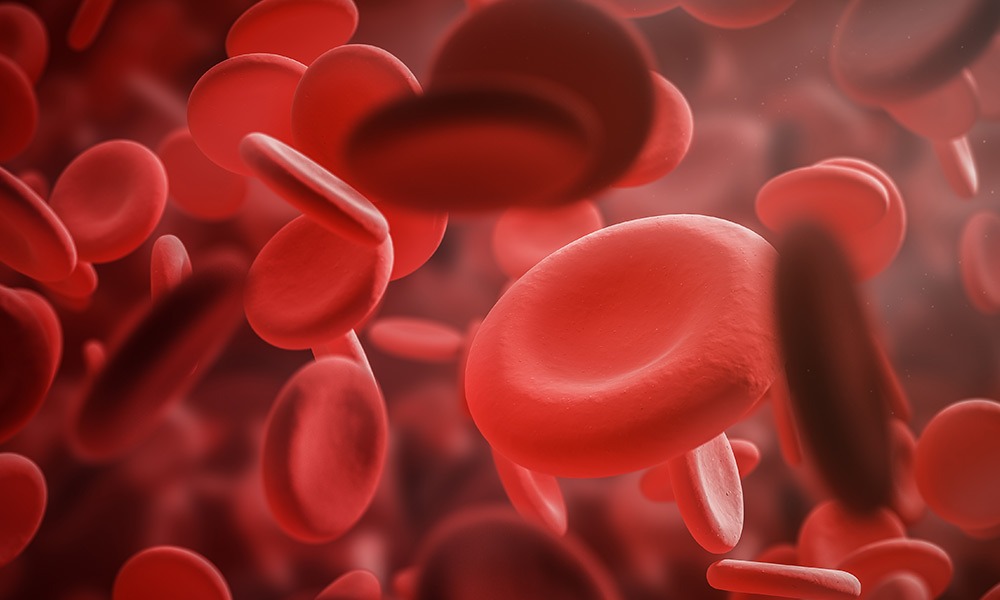Inhaltsverzeichnis
Der Standard im Labor: Das Blutbild
Das Blutbild ist eine standardisierte Laboruntersuchung und wird, wie der Name bereits vermuten lässt, aus einer Blutprobe ermittelt. Dabei gibt das Blutbild Auskunft über die Zellen, die sich in unserem Blut befinden. Dazu gehören die roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und die Blutplättchen (Thrombozyten).
Schließlich unterscheidet man das kleine und das große Blutbild. Das große Blutbild beinhaltet alle Werte des kleinen Blutbildes und ergänzt diese durch eine genauere Aufteilung der weißen Blutkörperchen. Je nachdem, wie die medizinische Fragestellung lautet, kann das kleine Blutbild ausreichen oder ein großes notwendig sein.
Kleines Blutbild
Das kleine Blutbild enthält Aussagen über die drei Zellarten des Blutes. Weichen die ermittelten Werte von den Referenzwerte ab, kann dies ein Hinweis auf bestimmte Erkrankungen sein. Dennoch können kleine Abweichungen auch bei gesunden Menschen durchaus vorkommen. Des Weiteren sind die Referenzwerte häufig von Labor zu Labor leicht unterschiedlich, warum diese bei der Auswertung des Blutbildes immer dabei sein sollten.
Analyse der roten Blutkörperchen (Erythrozyten)
Anzahl der Erythrozyten: Die Zellen, auf die man in unserem Blut am häufigsten trifft, sind die roten Blutkörperchen. Ihre Aufgabe ist es, den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Ist die Anzahl der Erythrozyten erhöht, kann dies auf einen Sauerstoffmangel oder einen erhöhten Bedarf unter anderem durch Stress hindeuten. Zu niedrige Werte finden sich beispielsweise bei verschiedenen Formen der Blutarmut (Anämie) oder bei einem Verlust von Blut.
Anzahl der Retikulozyten: Die Retikulozyten sind die Vorstufe der roten Blutkörperchen. Da die Erythrozyten im Knochenmark gebildet werden, ist ihre Vorstufe auch in der Regel nur dort vermehrt zu finden. Nur wenige Retikulozyten gelangen bei gesunden Menschen in den Blutkreislauf. Jedoch kann es bei einer vermehrten Produktion der roten Blutkörperchen auch zu einem vermehrten Übertritt der Retikulozyten ins Blut kommen. Eine Bestimmung der Retikulozyten erfolgt nicht immer, da er bei vielen Fragestellungen keine Aussagekraft hat.
Hämatokrit: Mit dem Hämatokrit Wert schätzt man in etwa den prozentualen Anteil der Zellen am gesamten Blutvolumen ab. In der Regel besteht das Blut zu etwas weniger als der Hälfte aus Zellen. Da die Erythrozyten fast das gesamte Zellvolumen ausmachen, wird dieser Wert anhand der roten Blutkörperchen gemessen. Demgemäß kann Flüssigkeitsmangel zu einem erhöhten Hämatokrit und ein Mangel an Erythrozyten zu einem erniedrigten Hämatokrit führen.
Hämoglobin: Das Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff der Erythrozyten. Es bindet Sauerstoff an sich und ermöglicht so den Transport zu den Körperzellen. Er verändert sich meist zusammen mit der Anzahl der Erythrozyten und kann beispielsweise bei Störungen im Hämoglobin-Stoffwechsel verändert sein.
Unterscheidung von Anämieformen
Mittleres korpuskuläres Volumen (MCV): Das MCV beschreibt das mittlere Volumen der roten Blutkörperchen. Anhand dieses Wertes kann man zwischen verschiedenen Arten der Blutarmut unterscheiden. Zum Beispiel könne bei einem Vitamin B12 oder Folsäuremangel nicht genügend Erythrozyten hergestellt werden, weshalb jeder Erythrozyt mit dem roten Blutfarbstoff vollgepackt wird. Dies soll die Sauerstoffversorgung weiterhin gewährleisten. Dabei ist das Volumen der roten Blutkörperchen erhöht. Andererseits kein unter anderem bei einem Eisenmangel nicht ausreichend Hämoglobin hergestellt werden und die Erythrozyten sind nicht ausreichend beladen. Darum sinkt bei Eisenmangel das MCV.
Mittleres korpuskuläres Hämoglobin (MCH): Dieser Wert trifft eine Aussage darüber, wie vollgepackt die Erythrozyten mit dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin sind. Folglich kommt es bspw. bei einem Vitamin B12 oder Folsäuremangel zu einem erhöhten und bei einem Eisenmangel zu einem erniedrigten Wert.
Mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration (MCHC): Die mittlere Hämoglobinkonzentration beschreibt das Verhältnis von dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin zum Volumen der roten Blutkörperchen und ändert sich entsprechend mit dem MCV und MCH.
Erythrozytenverteilungsbreite (RDW): Dieser Wert zeigt an, wie die Größenverteilung der Erythrozyten im Blut ist. Ein hoher Wert bedeutet, dass zu viele rote Blutkörperchen nicht den normalen Maßen entsprechen. Dies kann bei bestimmten Formen der Blutarmut vorkommen, bei der die Form der Erythrozyten von der Norm abweicht. Ein zu niedriger Wert hingegen sagt lediglich, dass besonders viele Erythrozyten eine normale Form haben und ist nicht krankhaft.
Analyse der weißen Blutkörperchen (Leukozyten)
Anzahl der Leukozyten: Die weißen Blutkörperchen sind Teil unseres Immunsystems. Damit lässt sich bereits herleiten, dass gerade bei Entzündungen und Infektionen den Wert erhöhen. Besteht eine Blutkrebserkrankung (Leukämie) ist die Anzahl der Leukozyten meist stark erhöht. Hingegen können eine Immunschwäche oder bestimmte Infektionen die Anzahl der Leukozyten senken.
Analyse der Blutplättchen (Thrombozyten)
Anzahl der Thrombozyten: Die Blutplättchen sind Teil der Blutgerinnung. Ist die Gerinnung gestört, kann der Wert verändert sein. So kann ein zu niedriger Wert für bestimmte Erkrankungen mit Blutungsneigung sprechen. Dagegen lassen zu hohe Werte eine überschießende Gerinnung mit der Gefahr von Blutgerinnseln vermuten.
Mittleres Thrombozytenvolumen (MPV): Vermutet man eine Störung der Thrombozyten, kann das mittlere Thrombozytenvolumen einen Hinweis darauf geben, um welche Störung es sich möglicherweise handelt.
Großes Blutbild
Im großen Blutbild sind alle Werte des kleinen Blutbildes enthalten. Zudem ergänzt es die Analyse der weißen Blutkörperchen. Während vorher alle Unterarten der Leukozyten zusammengefasst wurden, zeigt das sogenannte Differenzialblutbild genau, welche Arten von weißen Blutkörperchen sich in welcher Anzahl im Blut befinden.
Differenzialblutbild
Diese Ergänzung des kleinen Blutbildes kann vor allem bei Veränderungen der Leukozytenzahl einen Hinweis darauf geben, um welche Störung es sich handelt und welcher Teil des zellulären Immunsystems betroffen ist. Im Differenzialblutbild werden die Leukozyten genauer unterteilt in:
Neutrophile Granulozyten: Diese Zellen gehören zu der unspezifischen Abwehr und können potenzielle Krankheitserreger einerseits durch das Ausschütten bestimmter Substanzen bekämpfen und andererseits in sich aufnehmen. Sie machen im Normalfall den größten Anteil an Leukozyten aus.
Lymphozyten: Die Lymphozyten gehören der spezifischen Abwehr an. Sie unterteilen sich weiter in T‑Lymphozyten und B‑Lymphozyten, die mit verschiedenen Mechanismen wie beispielsweise der Bildung von Antikörpern gegen Gefahren für den Organismus angehen. Infolgedessen kümmern sie sich überwiegend um die Bekämpfung von Infektionen und veränderten körpereigenen Zellen. Sie sind nach den Neutrophilen Granulozyten die zweithäufigsten Leukozytenart.
Monozyten: Diese Zellart bekämpft Erreger hauptsächlich dadurch, dass sie diese in sich aufnimmt. Zudem können sie über das Blut und durch die Blutgefäße in Gewebe gelangen und dort Aufgaben des Immunsystems erfüllen.
Eosinophile und basophile Granulozyten: Diese beiden Granulozytenarten kommen wesentlich seltener vor als die neutrophilen Granulozyten. Allerdings sind sie an vielen Immunreaktionen beteiligt und ihre Anzahl kann sich beispielsweise durch allergische Reaktionen, Infektionen, Autoimmunerkrankungen, Parasitenbefall, Medikamenteneinnahme, Tumorerkrankungen und vielem mehr ändern.