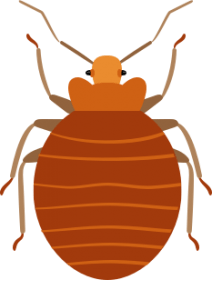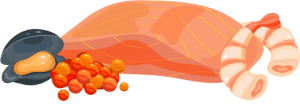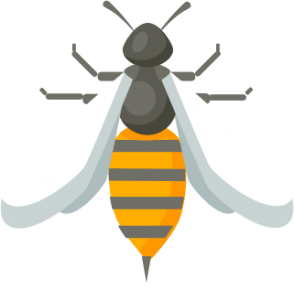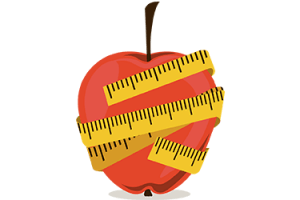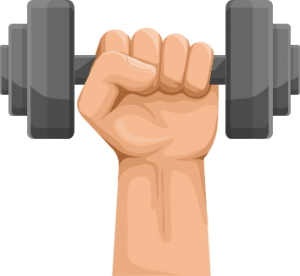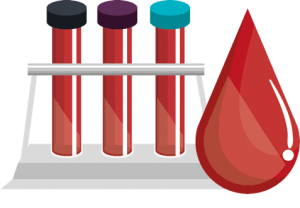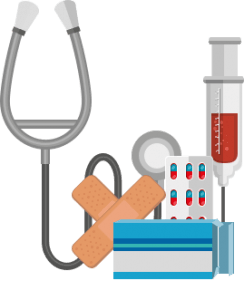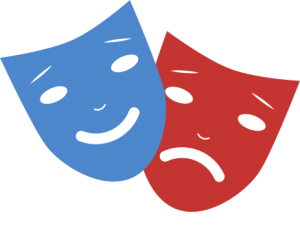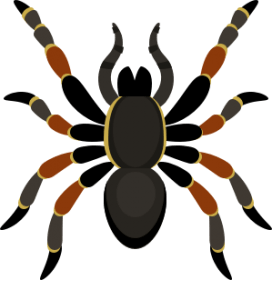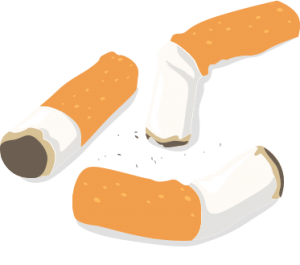Die Geburt des eigenen Kindes sollte einer der schönsten Momente im Leben sein. Sie stellt Frauen dabei jedoch vor eine enorme körperliche und emotionale Herausforderung. Das Leben als frischgebackene Eltern ändert sich von Grund auf und dieser Fakt muss zunächst verarbeitet werden. Einige Frauen verspüren in den Tagen nach der Geburt sogar eine zunehmende Melancholie gepaart mit Reizbarkeit und Angstzuständen. Hält dieser Zustand länger als zwei Wochen an, kann es sein, dass eine Wochenbettdepression und keine vorübergehende Stimmungskrise vorliegt.
Die Probleme bei der Diagnosestellung sind oftmals die Abgrenzung zum ’normalen’ Babyblues sowie der Stolz der Mutter. Viele Frauen behalten ihre Gefühle für sich, um nach außen hin das perfekte Mutterbild abzugeben. Sie reden sich dabei ein, stark sein zu müssen. Eine Wochenbettdepression ist jedoch eine ernstzunehmende Krankheit, die in den meisten Fällen einer Behandlung bedarf. Die Ursachen können dabei vielfältig sein und von der familiären Situation bis hin zu einer Erkrankung der Schilddrüse (Hashimoto Thyreoiditis) reichen. Offenheit über die eigenen Gefühle und Aufklärung über das Thema sind dabei oft die ersten Schritte zur Besserung und Enttabuisierung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Was ist eine Wochenbettdepression?
- 2 Abgrenzung zu anderen psychischen Krisen nach der Geburt
- 3 Entstehung
- 4 Häufigkeit der Wochenbettdepression
- 5 Symptome der Wochenbettdepression
- 6 Auswirkungen der Wochenbettdepression
- 7 Ursachen und Risikofaktoren
- 8 Diagnosefindung
- 9 Behandlung
- 10 Prognose
- 11 Quellen
Was ist eine Wochenbettdepression?
Eine Wochenbettdepression, auch bezeichnet als Kindbettdepression oder postnatale (lat. natus=Geburt) beziehungsweise postpartale (lat. partus=Entbindung) Depression, beschreibt eine ausgeprägte Traurig- und Hoffnungslosigkeit, die bei Frauen im ersten Jahr nach der Entbindung eintreten kann. Hinzu kommen können weitere Symptome einer klassischen Depression wie Antriebslosigkeit, innere Leere und Schuldgefühle. Frauen verspüren bei einer postpartalen Depression (PPD) zudem noch eine Gefühllosigkeit gegenüber dem Kind oder Ängste dieses nicht versorgen zu können. Die Ursachen der Entstehung können dabei vielfältig sein und von der Hormonumstellung über Probleme mit der Schilddrüse bis hin zum sozialen Umfeld reichen. Treffen kann es grundsätzlich jeden – auch die Väter. Fakt ist jedoch, dass man sich für diesen Umstand nicht schämen muss. Die Wochenbettdepression ist meist nur ein temporäres Phänomen, welches gut behandelt werden kann.
Abgrenzung zu anderen psychischen Krisen nach der Geburt
Im alltäglichen Sprachgebrauch wird die Wochenbettdepression meist mit anderen postpartalen Phänomen gleichgesetzt. Hierbei sind jedoch klare Grenzen zu ziehen:
Babyblues
Der Postpartum Blues beziehungsweise Babyblues bezeichnet eine vorübergehende Stimmungskrise in den ersten Tagen nach der Entbindung. Meist tritt sie am dritten Tag ein. Mütter weisen in dieser Zeit eine gesteigerte Sensibilität gepaart mit Reizbarkeit auf. Sie fühlen sich oft traurig und erschöpft und können ohne ersichtlichen Grund jederzeit in Tränen ausbrechen. Aufgrund dessen wird dieses Phänomen auch umgangssprachlich ‘Heultage’ genannt.
Rund 25 bis 80 % aller Mütter sind vom Babyblues betroffen. Diese Zahlen klaffen so weit auseinander, da die Unterscheidung zwischen Postpartum Blues und ’normalen’ Erschöpfungszuständen sehr subjektiv ist. Manche Menschen sehen Schlafstörungen und Müdigkeit als Selbstverständlichkeit nach einer Geburt an, andere wiederum nicht. Die Unterscheidung zur Wochenbettdepression liegt jedoch in der Schwere und Dauer der Symptome. Ein Babyblues hat meist nur leicht ausgeprägte Beschwerden, die nach spätestens zwei Wochen vorbei sein sollten. Halten diese länger an, kann eine Wochenbettdepression vorliegen. An sich hat der Postpartum Blues keinen Krankheitswert und muss nicht behandelt werden. Er ist weniger eine psychische Störung als ein ganz natürlicher Umstellungsprozess des Körpers während des Wochenbetts.
Postpartale Angstzustände
Nach einer Geburt ist es völlig normal, dass sich bestimmte Ängste entwickeln. Dazu gehört die Angst, dass dem eigenen Kind etwas zustoßen könnte, dass es krank wird oder dass man es nicht richtig oder ausreichend versorgt. Entwickeln sich diese Gedanken jedoch in eine zwanghafte Richtung und beginnen den Alltag zu dominieren, kann eine Angststörung vorliegen. Hinzu kommen können dabei auch Panikattacken. Eine Angststörung kann völlig unabhängig von einer Depression existieren, begünstigt jedoch die Entstehung selbiger.
Postpartale Psychose
Von 1.000 Geburten erleiden ein bis zwei Frauen eine Postpartale Psychose. Diese tritt in den ersten sechs Wochen auf, jedoch meist in der ersten oder zweiten. Die Symptome gleichen der einer postpartalen Depression sind jedoch um einiges gravierender in ihrer Intensität. Hinzu kommen psychotische Symptome wie Denk- und Verhaltensstörungen, Realitätsverlust, Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Eine postpartale Psychose muss umgehend stationär behandelt werden, da sonst im schlimmsten Fall ein Suizid oder Infantizid (Kindstötung) droht.
Entstehung
Eine PPD kann innerhalb des ersten Jahres nach der Geburt entstehen. In 70 % der Fälle tritt sie jedoch schon in den ersten zwei Wochen auf. Sie kann mehrere Wochen oder sogar Jahre dauern, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird. Leider wird die Erkrankung oft zu spät erkannt, da der Beginn oft schleichend und der Übergang von normalen Erschöpfungszuständen häufig fließend ist. Es ist daher sehr wichtig, dass das persönliche Umfeld auf Anzeichen und Wesensveränderungen achtet und die Betroffene gegebenenfalls darauf anspricht.
Es konnte nachgewiesen werden, dass Mütter, die stillen, ein viel geringeres Risiko aufweisen an einer postpartalen Depression zu erkranken, als Mütter, die nicht stillen. Dies liegt daran, dass beim Stillvorgang das Glückshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Die Stillzeit ist des Weiteren hervorragend geeignet die Mutter-Kind-Bindung zu stärken.
Häufigkeit der Wochenbettdepression
Von der Stimmungskrise nach der Geburt sind 10 bis 15 % aller Frauen betroffen. Die Quote ist bei jugendlichen Müttern jedoch weitaus höher. Von Frauen, die keinerlei depressive Vorerkrankungen besitzen, erkranken circa 8 % an der Wochenbettdepression.
Entgegen der allgemeinen Meinung können auch Väter unter postnatalen Depressionen oder einem Stimmungstief leiden. Circa 4 bis 8 % erkranken daran. Männer machen zwar keine hormonelle Umstellung durch, sehen sich mit dem neuen Zustand des Vaterseins jedoch überfordert. Oft sind die Depressionen des Vaters auch eine Reaktion auf die Wochenbettdepressionen der Partnerin, da sie sich in dieser Situation hilf- und machtlos fühlen.
Symptome der Wochenbettdepression
Die Symptome der Wochenbettdepression ähneln im Großteil der einer klassischen Depression. Sie können nur vereinzelt und in unterschiedlicher Intensität vorliegen. Hinzu kommen können noch ambivalente Gefühle dem Kind gegenüber. Viele betroffene Frauen sind ihrem Kind gegenüber ohne jegliche Gefühle. Dieser Umstand führt zu Selbstvorwürfen, da das in der Öffentlichkeit propagierte Mutterbild oft perfekt ist. Die meisten Mütter mit einer postpartalen Depression versorgen ihr Kind zwar ordnungsgemäß, jedoch eher wie einen Gegenstand ohne liebevolle Zuwendung. In gravierenden Fällen können sogar Aggressionen oder Gewaltfantasien gegenüber dem Neugeborenen entstehen. Tatsächliche Misshandlungen und Infantizid (Kindstötung) sind eher Symptome der postpartalen Psychose und äußerst selten.
Da der Beginn der Erkrankung meist schleichend ist und Symptome wie Schlafstörungen und Kopfschmerzen meist Resultat der neuen Lebensumstände sind, sollten Partner, Familie und Freunde genau darauf achten, ob eine Wesensveränderung der Mutter vorliegt. Ein ehrliches Nachfragen und Sprechen über das Befinden ist dabei meist schon eine große Hilfe.
- Energiemangel, Antriebslosigkeit
- Niedergeschlagenheit und Melancholie
- Gefühle von innerer Leere und Schuld
- gesteigerte Reizbarkeit
- Schlafstörungen
- sexuelle Unlust
- Ängste und Panikattacken
- Schwindel
- Appetitmangel
- Somatische Beschwerden: Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Herzbeschwerden
- Desinteresse, Aggressionen oder Gewaltfantasien dem eigenen Kind gegenüber
- Selbstverletzung und Selbstmordgedanken
Auswirkungen der Wochenbettdepression
Je nachdem wie stark die Wochenbettdepressionen ausgeprägt sind, kann sie Auswirkungen auf das Privat- und Sozialleben haben. Bei mittleren bis starken Wochenbettdepressionen vernachlässigt die Mutter meist die eigene Körperhygiene, den Haushalt und die sozialen Kontakte. Dieser Umstand mündet meist in sozialer Isolation.
Auch die Beziehung zum Partner kann erheblich unter einer postnatalen Depression leiden. Wenn der Vater nicht genügend über das Krankheitsbild informiert ist, kann er die Teilnahmslosigkeit der Betroffenen gegenüber dem Kind als fehlende Liebe missinterpretieren und seine Partnerin dafür verurteilen. Viele Väter fühlen sich auch aufgrund der meist lähmenden Traurigkeit der Mutter hilf- und machtlos. Dadurch distanzieren sich einige aus Selbstschutz emotional von der Partnerin. Um die Paarbeziehung auch weiterhin gesund zu halten, ist Verständnis und Aufklärung über die Krankheit essenziell.
Sind die Depressionen stark ausgeprägt oder liegt sogar eine postpartale Psychose vor, kann darunter die Beziehung zum Kind leiden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Mutter-Kind-Beziehung ein Leben lang problematisch bleibt und dass das Kind Störungen in seiner emotionalen und kognitiven Entwicklung sowie Verhaltensstörungen aufweist.
Ursachen und Risikofaktoren
Die Ursachen für die Wochenbettdepression sind noch nicht vollständig geklärt und manche Theorien sogar umstritten. Wahrscheinlich ist bei der Entstehung jedoch ein Zusammenwirken von mehreren Faktoren gegeben.
Hormonelle Umstellung
Als häufigste aller Ursachen wir oft die hormonelle Umstellung des weiblichen Körpers nach der Geburt genannt. Nach der Entbindung und vor allem nach der Geburt des Mutterkuchens sinkt im Körper der Östrogen- und Progesteronspiegel. Diese weiblichen Geschlechtshormone besitzen eine ausgleichende Wirkung auf das Gemüt und machen weniger anfällig für Depressionen und Psychosen. Des Weiteren steigt der Spiegel des Hormons Prolaktin nach der Geburt an, welches den Ruf hat, Stimmungskrisen und Wochenbettdepressionen auszulösen.
Eine Wochenbettdepression aufgrund einer hormonellen Veränderung klingt zwar einleuchtend, Mediziner konnten jedoch noch keinen eindeutigen Beweis für diese These liefern. Sie gilt daher als umstritten. Gegen diese These spricht, dass manche Frauen schon während der Schwangerschaft an einer Stimmungskrise leiden.
Umstellung des Stoffwechsels/ Erkrankung der Schilddrüse
Neben dem Hormonhaushalt verändert sich nach der Schwangerschaft auch der Stoffwechsel der Mutter. Dieser wird maßgeblich von der Schilddrüse gesteuert. Erkrankungen der Schilddrüse wie Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto Thyreoiditis entstehen meist in Phasen der Hormonumstellung. Dazu gehören Pubertät, Wechseljahre, Einnahme oder Absetzen der Pille und eben Schwangerschaften sowie Geburten. Bei einer Unterfunktion oder Hashimoto werden zu wenig Schilddrüsenhormone produziert, was zu einem langsameren Stoffwechsel führt. Daraus resultiert eine andauernde Müdigkeit. Fehlfunktionen der Schilddrüse stehen nicht selten im Zusammenhang mit depressiven Verstimmungen. Es ist daher ratsam, im ersten Jahr nach der Geburt seine Schilddrüsenwerte regelmäßig vom Arzt kontrollieren zu lassen.
Soziale Situation
Die soziale Situation und die familiären Umstände der Mutter können ebenfalls Einfluss auf die Entstehung einer Wochenbettdepression haben. Finanzielle Schwierigkeiten, eine problematische Wohnsituation und mangelnde Unterstützung seitens des Partners und der Familie verursachen Gefühle der Hoffnungslosig- und Einsamkeit. Psychische und physische Unterstützung sowie ein Gefühl der Geborgenheit sind maßgeblich für die geistige Gesundheit.
Psychische Vulnerabilität
In der Psychologie beschreibt die Vulnerabilität (Verletzlichkeit) den Grad der Resilienz (Widerstandsfähigkeit) einer Person gegenüber Stress, Problemen und belastenden Situationen. Ein vulnerabler Mensch lässt sich von Ereignissen schnell aus der Bahn werfen und erholt sich nur schwer von Stress. Diese Personengruppe ist generell anfälliger für psychische Erkrankungen. Wie verletzlich wir sind, wird zum einen von unseren Genen und zum anderen von unseren Lebenserfahrungen bestimmt, wobei nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die Gene eine wahrscheinlich größere Rolle spielen.
Verletzliche Menschen haben oft zu hohe Ansprüche an sich selbst, die nicht erfüllt werden können. Im Fall der Wochenbettdepression ist es ein übersteigertes Mutterbild, dem die Betroffenen entsprechen möchten.
Des Weiteren liegt eine erhöhte Vulnerabilität vor, wenn in der Vergangenheit bereits Erfahrungen mit mentalen Problemen gemacht wurden. Eine Mutter, die in ihrem bisherigen Leben bereits Depressionen, Zwänge oder Angststörungen durchlebt hat, besitzt ein viel höheres Risiko an einer Wochenbettdepression zu erkranken als Frauen, die stets mental gesund waren.
Auch sind Frauen generell anfälliger für Wochenbettdepressionen, wenn diese bereits in der Familiengeschichte vorkamen, die Frau welche bei vorherigen Geburten erlitt oder die Frau beim Eintreten der Regelblutung regelmäßig über depressive Verstimmungen klagt.
Traumata
Eine erhöhte Vulnerabilität bezüglich einer Wochenbettdepression besitzen auch Frauen, die in ihrer Vergangenheit Traumata erleben mussten. Dazu gehören einschneidende Erlebnisse, sexueller Missbrauch oder häusliche Gewalt. Viele Menschen entwickeln daraufhin eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), bei der durch bestimmte Trigger alte Gefühle wieder an die Oberfläche treten und eine Retraumatisierung stattfinden kann.
Körperliche und geistige Erschöpfung
Gerade nach der Geburt des ersten Kindes ist die Umstellung der Lebensumstände sehr groß. Eltern sehen sich mit kurzen und schlaflosen Nächten konfrontiert, da Babys in den ersten Wochen und Monaten noch nicht die Nacht durchschlafen können. Dieser Schlafmangel erzeugt Tagesmüdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche und Reizbarkeit. Je länger und schlimmer der Mangel an Schlaf, umso dünner wird das Nervenkostüm mit der Zeit. Dies kann bei Frauen mit einer hohen Vulnerabilität schnell zu einer Wochenbettdepression führen. In einer Paarbeziehung sollten sich die Eltern regelmäßig bei der nächtlichen Versorgung abwechseln, um die Schlafenszeit der Mutter zu erhöhen.
Besonders ein sogenanntes ‘Schreibaby’ hält die Eltern die ganze Nacht wach. Der Begriff beschreibt Kinder, die besonders viel und exzessiv schreien. Hilfe hierfür bieten mehrere Schreiambulanzen in Deutschland. Hier werden Eltern Verhaltensstrategien für die Interaktion mit dem Kind mit an die Hand gegeben und es wird aktiv an der Beziehung zum Kind gearbeitet.
Während durch den Schlafmangel eine körperliche Erschöpfung eintritt, schleicht sich auch eine geistige Erschöpfung durch die Monotonie der Tagesgestaltung ein. Frischgebackene Mütter haben nun wenig Zeit für sich selbst und verbringen den Großteil des Tages mit der Versorgung des Neugeborenen. Freizeit und Sozialleben werden dann erst einmal auf ein Minimum reduziert oder komplett gestrichen. Für Frauen, die vorher mitten im (Berufs-) Leben standen, kann diese eintönige Lebenssituation mit fehlenden geistigen Stimuli belastend sein.
Schwierige Geburt/ ungewolltes Kind
Die Entwicklung einer Wochenbettdepression steht ebenfalls im Zusammenhang mit dem Vorgang der Geburt selbst. Vielleicht wollte die Frau zu Hause entbinden und musste dann doch in die Klinik. Womöglich hat sie sich eine natürliche Geburt gewünscht und es musste doch ein Kaiserschnitt durchgeführt werden. Unter Umständen gab es schwerwiegende Komplikationen, die das Leben von Mutter und Kind gefährdet haben. Bei all diesen unglücklichen Fällen kann bei der Betroffenen eine negative Konnotation zur Geburt und damit zum Kind an sich entstehen, welches ein Symptom der PPD darstellt.
Ein schwieriges Verhältnis zum eigenen Baby kann ebenfalls entstehen, wenn es kein Wunschkind ist. Möglicherweise passt es nicht in die eigenen Lebensumstände oder ist sogar das Resultat einer Vergewaltigung oder ungesunden Beziehung. In diesen Fällen können Hassgefühle dem Erzeuger gegenüber auf das Kind projiziert werden, was sehr fatal sein kann.
Diagnosefindung
Es gibt keine allgemeine Vorgehensweise, um Wochenbettdepressionen zu diagnostizieren.
Um jedoch körperliche Ursachen ausschließen zu können, ist es wichtig, im ersten Jahr nach der Geburt regelmäßig die Schilddrüsenwerte in einer Endokrinologie kontrollieren zu lassen. Durch die Hormonumstellung kann sich nämlich eine Unterfunktion oder die Autoimmunerkrankung Hashimoto Thyreoiditis entwickeln. Diese beiden Erkrankungen begünstigen wiederum die Entstehung von Depressionen.
Konnten physische Ursachen wie eine fehlerhafte Schilddrüsenfunktion ausgeschlossen werden, liegt es an Partner und Umfeld eventuelle Wesensveränderungen der Frau zu beobachten und die Mutter neutral darauf anzusprechen. Auch die Mutter sollte sich selbst und ihren Gefühlen offen gegenüber stehen und keinen falschen Stolz beziehungsweise übersteigertes Mutterbild besitzen.
Auch der behandelnde Frauenarzt, der Hausarzt und die Hebamme stehen in der Verantwortung, regelmäßig nach dem Befinden der Patientinnen zu fragen und die Antworten kritisch zu bewerten.
Zur Bewertung, ob und in welchem Schweregrad eine Wochenbettdepression vorliegt, kann die Edinburgh-Postnatal-Depression-Scale (EPDS) hilfreich sein. Es handelt sich dabei um einen Fragebogen mit zehn Äußerungen, bei denen die Frau bewerten muss, in welchem Maß diese jeweils auf sie zutreffen und wie niedergeschlagen sie ist. Dieser Fragebogen wird gerne von Ärzten als Anhaltspunkt benutzt, kann jedoch auch zu Hause zur ersten Selbsteinschätzung für die Mutter selbst dienen.
» Hier geht es zum Selbsttest «
Behandlung
Leichte Depressionen: Bei leichten Depressionen kann es schon enorm hilfreich sein, offen über das Thema und die eigenen Gefühle zu reden. Man sollte sein Umfeld ausreichend informieren, um emotionale und physische Unterstützung zu erhalten. Neben der Unterstützung durch Partner, Familie und Freunde kann man sich auch professionelle Hilfe durch eine Hebamme, ein Kindermädchen oder eine Haushaltshilfe suchen. Durch die Entlastung kann sich die Mutter um einiges schneller regenerieren und zu ihrer alten Form zurückfinden. Sollten die Beschwerden durch ein Schreibaby verursacht werden, hilft die Konsultation einer Schreiambulanz für eine bessere Interaktion mit dem Kind.
Mittlere Depressionen: Für die Behandlung mittlerer Wochenbettdepressionen reicht die Hilfe des Umfeldes meist nicht mehr aus. Es sollte ein Psychotherapeut aufgesucht und eine ambulante Therapie in Anspruch genommen werden. Hilfreich für eine PPD können eine Gesprächs- oder Verhaltenstherapie sein. Wichtig ist dabei, dass auch der Partner und die Familie in die Therapie mit einbezogen werden, um ein Verständnis für die Krankheit zu generieren. Bei Bedarf können zusätzlich noch Antidepressiva verschrieben werden. Die Wirkstoffe dieser Medikamente können jedoch in die Muttermilch übergehen. Sollte die Medikation während der Stillzeit stattfinden, kann der Frauenarzt beziehungsweise Therapeut Auskunft geben, welches Präparat stillverträglich ist.
Schwere Depressionen: Bei schweren Depressionen reicht eine ambulante Psychotherapie nicht mehr aus und ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik ist unumgänglich. Für Wochenbettdepressionen gibt es spezielle Mutter-Kind-Kliniken, die eine optimale Versorgung des Kindes gewährleisten. Auch wird hier mit den Patientinnen aktiv an ihrer Beziehung zum Kind gearbeitet. Bei einem schweren Verlauf der Krankheit ist die Einnahme von Antidepressiva unentbehrlich. Bei der Medikation kommen meist trizyklische Antidepressiva oder Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer zum Einsatz, die schon nach ein paar Wochen eine signifikante Besserung herbeibringen können.
Prognose
Nach der Schwangerschaft an einer Wochenbettdepression zu erkranken ist keine Schande und in den meisten Fällen völlig ungefährlich. Es besteht kein Grund zur Hoffnungslosigkeit, da leichte Verläufe der Krankheit mit genügend Unterstützung meist von alleine wieder ausheilen. Auch die Prognosen für mittlere bis schwere PPD sind sehr gut. Je frühzeitiger die Krankheit erkannt und die Behandlung begonnen wird, umso besser und schneller kann sie wieder kuriert werden. Die Postnatalen Depressionen sind meist ein temporäres Phänomen, von dem sich der Großteil der Frauen wieder vollständig erholt.
Quellen
- EPDS-Test
- Aerzteblatt — Postpartale Depression: Vom Tief nach der Geburt
- DocCheck Flexikon — Wochenbettdepression
- DGPM — Wochenbettdepression nicht auf die leichte Schulter nehmen
- Babelli — Liste der Schreiambulanzen in Deutschland
- Bundesverband der Frauenärzte e.V. — Frauenärzte im Netz
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung