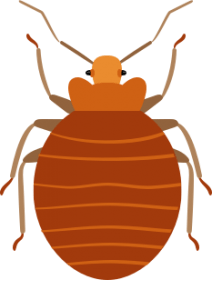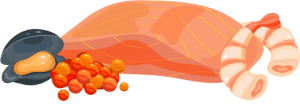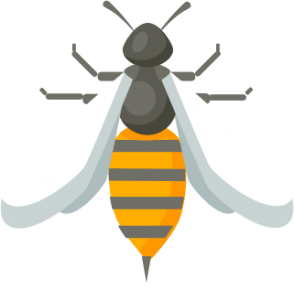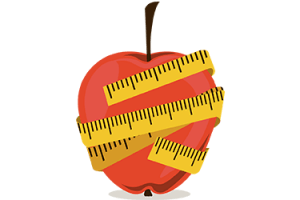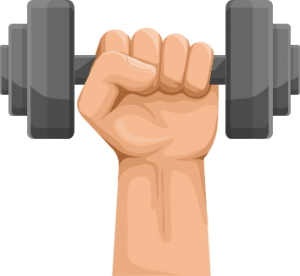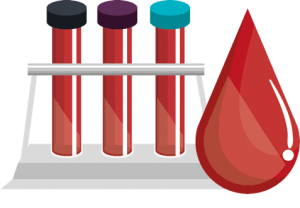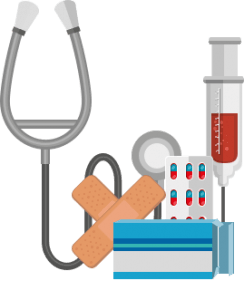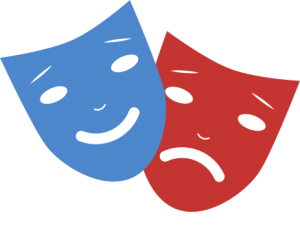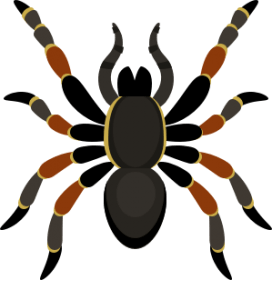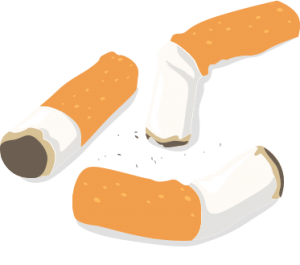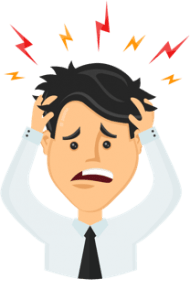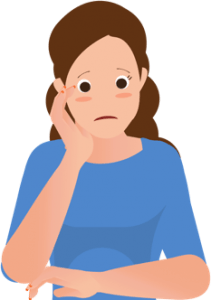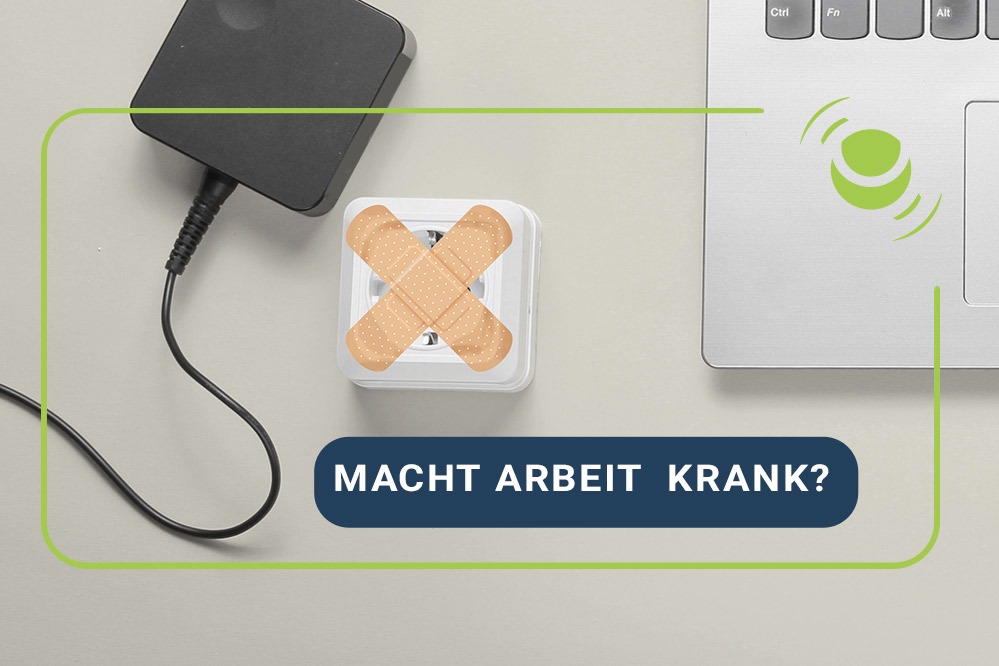Ob Depressionen, eine Angststörung, Zwänge oder andere psychische Erkrankungen, die Psychotherapie gehört bei seelischen Problemen zu den besonders wirksamen Behandlungsmethoden. Die gängigen und wissenschaftlich fundierten Therapieverfahren lassen sich dabei fünf übergeordneten Formen zuordnen.
Inhaltsverzeichnis
Welche anerkannten Therapieformen gibt es?
Wissenschaftlich anerkannt sind in Deutschland die Verhaltenstherapie, die analytische Psychotherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Therapie, die systemische Therapie und die Gesprächspsychotherapie. Trotz der erwiesenen Wirksamkeit werden allerdings nur die ersten drei der genannten Formen von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.
Verhaltenstherapie
Bei der Verhaltenstherapie sollen Patienten in der Vergangenheit erlernte Verhaltensmuster durch neue Erfahrungen und Gewohnheiten ersetzen. Im Rahmen der Therapie wird das Problem zunächst in Bezug auf die genauen Auslöser und die Umstände des Auftretens analysiert. Anschließend erarbeiten Therapeut und Patient neue Problemlösungsansätze und Verhaltensmodelle, mit denen der Patient in Zukunft besser mit beispielsweise beängstigenden Situationen umgehen kann.
Im Rahmen der schrittweisen Konfrontation setzen sich die Patienten schließlich nach und nach bewusst mit ihrem Problem auseinander und trainieren ihre Fähigkeiten direkt im Alltag. Erfahrungen und Erlebnisse, die die Probleme verursacht haben, stehen nicht im Vordergrund einer Verhaltenstherapie.
Analytische Psychotherapie
Die analytische Psychotherapie setzt demgegenüber bewusst an Erfahrungen aus der Kindheit eines Patienten an. Anknüpfend an die Lehren von Sigmund Freud werden frühkindliche Prägungen als Auslöser für aktuelle Probleme eingeordnet. Bei der Therapie soll sich der Patient diesen zumeist verdrängten Erfahrungen wieder bewusst werden und kann sie anschließend aktiv bearbeiten. Der Therapeut nimmt bei der analytischen Therapie eine neutrale Rolle ein und regt eine ganzheitliche Bearbeitung der Probleme an.
Tiefenpsychologische Psychotherapie
Die tiefenpsychologische Psychotherapie setzt ebenfalls am unbewussten Erleben und Verhalten des Patienten an. Nicht ausreichend verarbeitete Konflikte können demnach das Verhalten in der Gegenwart beeinflussen und müssen zur aktiven Problembearbeitung ins Bewusstsein zurückgeholt werden. Unterschiede zur analytischen Therapie bestehen allerdings in der Rolle des Therapeuten und dem konkreten Problemlöseansatz. Tiefenpsychologisch arbeitende Psychotherapeuten lenken das Gespräch aktiver und orientieren sich bei der Lösungssuche an konkreten Problemstellungen.
Systemische Therapie
Bei der systemischen Therapie steht die Beziehung des Patienten zu seiner Umwelt im Vordergrund der Betrachtungen. Je nach konkretem Therapieansatz werden etwa die Beziehungen zur Familie oder anderen wichtigen Bezugspersonen analysiert und in die Therapie miteinbezogen. Mithilfe von Gesprächen in verschiedenen Gruppenkonstellationen sollen gestörte Kommunikationsstrukturen aufgespürt und positiv verändert werden.
Gesprächstherapie
Die Gesprächspsychotherapie geht von positiven Entwicklungskräften jeder Person aus, die durch ungünstige Einflüsse jedoch blockiert sein können. Im Rahmen individueller, auf persönlicher Ebene geführter Gespräche lernen Patienten sich selbst und ihre Handlungsmotive besser kennen und entwickeln auf dieser Basis Ansätze, sich positiv zu verändern. Da der Therapeut sich bei dieser Therapieform aktiv und auf persönlicher Ebene in die Sitzungen einbringt, ist das gute Verhältnis zwischen ihm und seinem Patienten von besonderer Bedeutung.
Unter welchen Voraussetzungen ist eine Psychotherapie zu empfehlen?
Alltägliche seelische Belastungen, mit denen Betroffene nicht mehr alleine zurechtkommen, sollten den Anstoß geben, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Abhängig von der individuellen Lebenssituation können sich diese alleine nicht zu bewältigenden Probleme in unterschiedlichsten konkreten Gedankenmustern und Symptomen äußern. Neben psychischen Beschwerden können dazu auch körperliche Symptome wie Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Übelkeit, Schwindel oder Schmerzen gehören.
Voraussetzung dafür, dass eine Therapie Erfolge erzielen kann, sind allerdings unabhängig von der gewählten Therapieform, die Bereitschaft zur Arbeit an und zur Auseinandersetzung mit sich selbst. Patienten brauchen zudem den Willen, Veränderungen anzugehen.
Die passende Therapieform auswählen
Welche Therapieform sich zur Behandlung seelischer Probleme am besten eignet, lässt sich nach aktuellem Forschungsstand nicht pauschal beantworten. Ausgangspunkt für eine fundierte Entscheidung sollten daher persönliche Motive und Präferenzen sowie gegebenenfalls das Vertrauensverhältnis zwischen potenziellem Therapeuten und dem Patienten sein. Folgende Leitfragen helfen bei der Auswahl:
- Möchte sich der Patient mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen und bei tief gehenden Gesprächen den Ursachen seiner Probleme auf den Grund gehen? In diesem Fall ist die analytische oder tiefenpsychologische Therapie geeignet.
- Soll die aktive Bewältigung aktueller Probleme im Vordergrund stehen und ist der Patient bereit, seine Schwierigkeiten mit konkreten Übungen im Alltag anzugehen? Dann kommt eine Verhaltenstherapie in Betracht.
- Werden Beziehungsprobleme oder familiäre Konflikte als Auslöser der Probleme vermutet? Eine systemische Therapie kann in diesem Fall helfen.
- Sucht der Patient die vertiefte Auseinandersetzung mit sich selbst und legt Wert auf eine sehr vertrauensvolle Beziehung zum Therapeuten? Hier kann eine Gesprächspsychotherapie die optimale Entscheidung sein.
Eine Psychotherapie beantragen
Ist die Entscheidung für eine Psychotherapie gefallen, können Patienten mögliche Therapeuten im ersten Schritt frei wählen. Die nötigen Adressen lassen sich im Internet recherchieren. Damit die Therapie später übernommen wird, sollte jedoch bereits vor der Kontaktaufnahme unbedingt geklärt werden, ob der Therapeut eine Kassenzulassung besitzt.
Ist diese Voraussetzung gegeben, steht nach persönlicher Terminvereinbarung ein Vorabgespräch mit dem gewählten Psychologen an, bei dem dieser eine Empfehlung für die weitere Behandlung ausspricht. Im Anschluss an dieses Gespräch haben Kassenpatienten Anspruch auf zwei bis vier Probesitzungen, bevor der Psychotherapeut die endgültige Diagnose stellt und ein entsprechendes Gutachten verfasst. Nach einer allgemeinen Untersuchung beim Hausarzt, der körperliche Ursachen für die Probleme ausschließt, kann die Therapie nun endgültig beantragt werden. Passende Formulare stellen die einzelnen Krankenkassen bereit. Bei Privatpatienten sind darüber hinaus abweichende Regelungen möglich. Hier sind die Konditionen des eigenen Anbieters zu prüfen.
Den passenden Therapeuten finden
Doch welcher Therapeut ist nun der richtige? Das ausschlaggebende Kriterium sollte die Sympathie zwischen Patient und Psychotherapeut sein. Diese beeinflusst den Therapieerfolg nachweislich am meisten. Verfügt der Therapeut zudem über eine Zulassung, ist die fachliche Qualifikation gewährleistet, sodass der erfolgreichen Therapie nichts im Wege steht.