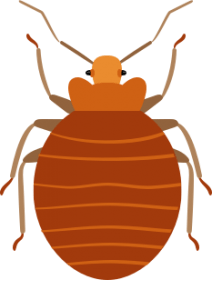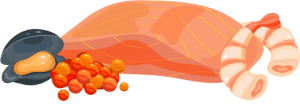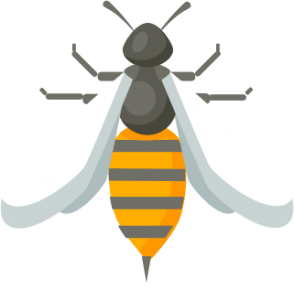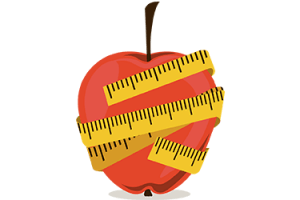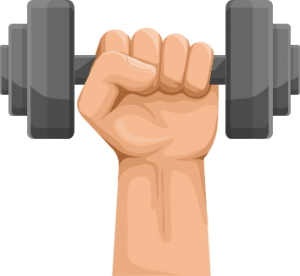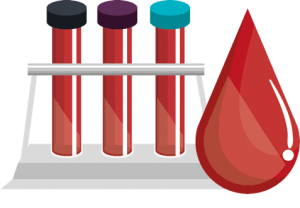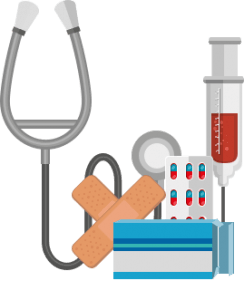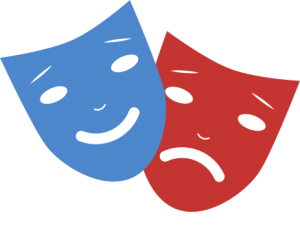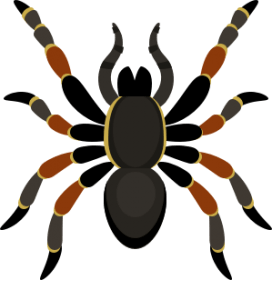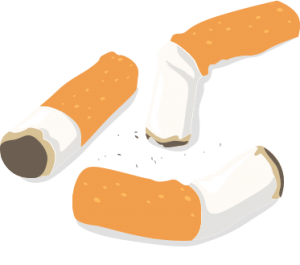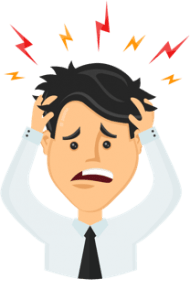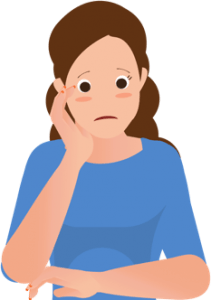Wir tragen es in unseren Knochen und Zähnen und wissen, dass es vor allem in Milchprodukten enthalten ist. Die Rede ist von Calcium. Weniger bekannt ist jedoch, dass Calcium mengenmäßig der wichtigste Mineralstoff im menschlichen Körper ist, wichtig für jede einzelne Körperzelle und deren Signalübertragung und für die Weiterleitung der Reize im Nervensystem.
Beeinflusst wird der Calciumspiegel im Blut durch Hormone, Vitamin D, den Phosphat-Stoffwechsel und die Nahrungsaufnahme. Als Elektrolyt ist Calcium zusammen mit den weiteren Elektrolyten Natrium, Magnesium, Kalium, Chlorid und Phosphor mitverantwortlich für die Regulierung der Muskel- und Nervenfunktion, sowie für den Wasserhaushalt und den Säure-Basenhaushalt. Doch wie gut sind wir in der Regel durch unsere Ernährung mit Calcium versorgt und ist es sinnvoll, Calciumpräparate zu uns zu nehmen?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Wofür benötigt der Körper Calcium?
- 2 Calciumbedarf – wie viel Calcium benötigt der Mensch?
- 3 Calciummangel – mögliche Ursachen, Risikogruppen und Folgen
- 4 Welche Nahrungsmittel sind gute Calciumquellen?
- 5 Calcium Supplements – was gilt es bei der Einnahme zu beachten?
- 6 Calcium Überdosierung
- 7 Fazit
Wofür benötigt der Körper Calcium?
Besonders zur Vorbeugung einer Osteoporose ist Calcium wichtig. Osteoporose ist eine Krankheit des Skelettsystems, bei der sich die Knochenmasse verringert, der Knochen brüchig wird und es leichter zu Knochenbrüchen kommen kann. Daher ist es vor allem im Kindesalter bedeutsam, die maximale Knochenmasse zu optimieren und im Alter den Knochenabbau zu minimieren. Das im Körper mengenmäßig am meisten vorkommende Elektrolyt ist Calcium mit einem Gewicht von circa 1 kg. Schon gewusst? 99 % des Calciums wird in unseren Knochen und Zähnen gespeichert, während sich nur 1 % im Blut und anderen Geweben befindet.
Bei der Vitamin D‑Aufnahme ist der Mensch nicht ausschließlich auf die Nahrung angewiesen, denn es wird bei ausreichender Sonneneinstrahlung in der Haut selbst gebildet. In den Nieren entsteht anschließend das eigentliche Vitamin-D-Hormon. Dieses veranlasst, dass in der Darmwand ein Protein gebildet wird, welches die Calciumionen vom Darm ins Blut transportiert. Bei einem Vitamin-D-Mangel wird weniger Calcium aufgenommen, was schwere Folgen für die Knochenmineralisierung mit sich bringen kann. Besonders bei Kindern kann es zu einer Knochenverformung, der Rachitis, kommen, wenn zu wenig Vitamin D zugeführt wird. Zudem spielt körperliche Aktivität eine wichtige Rolle.
Wichtig ist auch das Verhältnis von Calcium und Phosphat in der Nahrung. Phosphat wird bis zu 60 % resorbiert und ist Calcium dadurch überlegen. Wenn nun wesentlich mehr Phosphat als Calcium aufgenommen wird, steigt der Phosphatgehalt des Blutes an. Der Körper mobilisiert Calcium aus den Knochen, da er versucht, ein ausgewogenes Calcium-Phosphat-Verhältnis im Blut aufrechtzuerhalten und das Ungleichgewicht auszugleichen. Durch viel Phosphat in der Nahrung wird die Resorption von Calcium vermindert. Dies ist kein Problem bei einer ausgewogenen und naturbelassenen Ernährung, allerdings wird durch die heutigen Ernährungsgewohnheiten mit viel Fleisch, Wurst und Fertigprodukten im Durchschnitt mehr Phosphat zugeführt als Calcium.
Calciumbedarf – wie viel Calcium benötigt der Mensch?
Der Calciumbedarf ist altersabhängig. Im Jugendalter von 13 bis 18 Jahren benötigt man aufgrund des starken Wachstums am meisten Calcium. Die empfohlene Calciumzufuhr in diesem Alter liegt bei 1200 mg pro Tag. Im Alter von 10 bis 12 liegt sie bei 1100 mg am Tag. Ab dem Erwachsenenalter sollte man täglich 1000 mg Calcium am Tag zu sich nehmen.
Empfohlene Zufuhr von Calcium
| Alter | Calcium |
| mg/Tag | |
| Säuglinge | |
| 0 bis unter 4 Monate | 220 |
| 4 bis unter 12 Monate | 330 |
| Kinder | |
| 1 bis unter 4 Jahre | 600 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 750 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 900 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 1100 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 1200 |
| Jugendliche und Erwachsene | |
| 15 bis unter 19 Jahre | 1200 |
| Ab 19 | 1000 |
Die durchschnittliche Calciumzufuhr in Deutschland liegt laut der Nationalen Verzehrsstudie II bei Männern bei 807 mg und bei Frauen bei 738 mg pro Tag. Nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern liegt die Zufuhr unterhalb der empfohlenen Zufuhrmenge. Dies bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass ein Mangel vorliegt. Allerdings sollte bei einer Unterversorgung gezielt auf calciumhaltige Lebensmittel geachtet werden.
Calciummangel – mögliche Ursachen, Risikogruppen und Folgen
Da die Knochen Calcium speichern und es bei Bedarf an das Blut abgeben können, bleibt die Calciumkonzentration im Blut auch bei einer geringen Zufuhr zunächst im Normalbereich. Ein Calciummangel entsteht zum Beispiel durch eine verminderte Calciumaufnahme aus der Nahrung, Nierenkrankheiten oder Hormonstörungen, seltener durch einen erhöhten Calciumverlust oder Bedarf und kann lebensbedrohlich sein.
Verschiedene Faktoren können den Spiegel unter den Normbereich sinken lassen. Dann tritt ein Calciummangel, eine sogenannte Hypokalzämie, auf. Mögliche Ursachen sind zum Beispiel eine gestörte Aufnahme von Vitamin D oder Calcium, Niereninsuffizienz, eine Unterfunktion der Nebenschilddrüsen, akute Bauchspeicheldrüsenentzündung oder auch bestimmte Medikamente wie Antiepileptika, Kortison sowie einige Diuretika. Auch ein erhöhter Kaffee- oder Alkoholkonsum, Magnesiummangel, Glutenunverträglichkeit und Essstörungen wie Bulimie oder Magersucht können zu einem Mangel an Calcium führen.
Bei einem Calciummangel baut der Körper Knochenmasse ab, um die Calciumkonzentration im Blut aufrechtzuerhalten. Der Knochen wird instabil und es kann zu einer Knochenerweichung führen. Bei Kindern wird dies Rachitis genannt und bei Erwachsenen Osteomalazie. Risikogruppen für einen Calciummangel sind vor allem Schwangere und Stillende, Veganer, ältere Menschen, Menschen mit Lactoseintoleranz und Jugendliche im Wachstum.
Symptome eines Calciummangels sind Übererregbarkeit der Muskeln und Nerven, Fühlstörungen und Kribbeln in Händen und Armen. Ein Calciummangel kann zu Muskelkrämpfen, Bauchschmerzen, Entkalkung von Knochen und Zähnen, einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche (Osteoporose), Knochenverformungen mit Rückenproblemen, motorischen Störungen, bis hin zum erhöhten Risiko für eine Linsentrübung oder Herz-Kreislaufprobleme führen. Bei einem Calciummangel, der durch einen Mangel am Nebenschilddrüsenhormon Parathormon – welches den Calciumstoffwechsel reguliert – entsteht, können außerdem verschiedene Organe verkalken. Davon betroffen sind häufig Augen und Gehirn. Daraufhin kann sich das Sehvermögen verschlechtern und es kann zu Kopfschmerzen, Demenz oder Bewegungs- und Sprachstörungen kommen. Bei Kindern können auch Minderwuchs und Zahnentwicklungsstörungen auftreten.
Ob ein Calciummangel vorliegt, kann ein Arzt durch eine Blutuntersuchung feststellen. Bei einem Blutcalciumspiegel unter 2,2 mmol/l liegt eine Hypokalzämie, also ein Mangel, vor. Häufig wird eine ausgewogenere Ernährung empfohlen, um diesem Mangel entgegenzuwirken. Präparate mit Calcium und Vitamin D können allerdings auch eingesetzt werden, um die Calciumkonzentration im Blut zu erhöhen. Experten empfehlen, hochdosierte Calciumpräparate nur auf ärztliche Anweisung einzunehmen, da es schnell zu einem Calciumüberschuss kommen kann.
Wirkt sich Zucker auf Calcium aus? Wissenschaftlich nicht bestätigt ist die Annahme, dass Zucker dem Körper Calcium entzieht. Diese Behauptung geht auf eine Einzelstudie an Kaninchen aus dem Jahr 1926 zurück, in der unter chronischer Zuckerfütterung Veränderungen an den Knochen ersichtlich wurden. Forschern wiesen allerdings auf das fehlende Vitamin D und viele andere Nährstoffe in dem verwendeten Futter vorhanden waren.
Welche Nahrungsmittel sind gute Calciumquellen?
Im Durchschnitt scheiden wir rund 300 mg Calcium am Tag aus. Dieser Verlust muss über die Nahrung ausgeglichen werden. Verschiedene Lebensmittel weisen einen hohen Calciumgehalt auf. Vor allem Milchprodukte enthalten viel Calcium. Mit bis zu 900 mg pro 100 g sind sie sogar Calciumlieferant Nummer 1. Milch und Joghurt enthalten pro 100 g circa 120 mg, Käse circa 400 bis 900 mg. Auch grünes Gemüse wie Rucola, Grünkohl oder Brokkoli und Nüsse wie Hasel- und Paranüsse sind mit bis zu 100 mg pro 100 g wichtige Calciumquellen. Mineralwasser mit mehr als 150 mg Calcium beziehungsweise Heilwasser ab 250 mg pro einen Liter gelten zudem als calciumreich.
Durch die Nahrung können in der Regel Menschen jeden Alters die empfohlene Calciumzufuhr erreichen.

Doch auch bei komplettem Milch- und Milchproduktverzicht kann durch calciumreiches Gemüse wie Brokkoli, Nüsse und calciumreiches Mineralwasser ein Mangel ausbleiben. Eine vollwertige Ernährung kann nicht zu einer Calcium Überdosierung führen.
Bei veganer Ernährung bei Kleinkindern gilt Vorsicht, da diese oft nur 50 Prozent der empfohlenen Calciumzufuhr zu sich nehmen. Sie sollten in Rücksprache mit dem Kinderarzt zusätzlich Calcium erhalten, ebenso wie Kinder, die wegen einer Milcheiweißallergie keine Milchprodukte vertragen. Im Säuglings- und Kleinkindalter kann Spezialnahrung auf Soja- oder Kuhmilchbasis gegeben werden, die mit Calcium und anderen Nährstoffen angereichert ist. Auch durch calciumreiches Mineralwasser und angereicherte Fruchtsäfte kann die Zufuhr zusätzlich gesteigert werden. Wird die leicht bittere Milchersatznahrung und calciumhaltige Gemüsesorten von Kindern ablehnt, sollte unter ärztlicher Kontrolle der Bedarf durch ein niedrig dosiertes Calciumpräparat gedeckt werden.
Calcium Supplements – was gilt es bei der Einnahme zu beachten?
Die optimale Einnahmezeit für Nahrungsergänzungsmittel mit Calcium ist während einer Mahlzeit. Die Einnahme sollte laut Empfehlungen auf zwei Einzeldosen über den Tag verteilt werden. Calciumhaltige Nahrungsergänzungen werden von Apotheken, Drogerien und im Internet angeboten und obwohl Nahrungsergänzungsmittel mit Calcium nicht rezeptpflichtig sind, sind dennoch einige Calciumpräparate apothekenpflichtig. Erhältlich sind Calciumtabletten, Calciumkapseln, und Calciumpulver. Diese gibt es auch mit unterschiedlichem Calciumgehalt. Häufig werden Calciumpräparate mit anderen Nährstoffen wie Magnesium oder Vitamin D3 kombiniert.
Folgende Calciumverbindungen sind in Nahrungsergänzungsmitteln erlaubt:
- Calciumcarbonat
- Calciumchlorid
- Calciumsalze der Zitronensäure (Kalziumcitrat)
- Calciumgluconat
- Calciumglycerophosphat
- Calciumlactat
- Calciumsalze der Orthophosphorsäure
- Calciumhydroxid
- Calciumoxid
Vorsicht: Nicht jede Calciumverbindung ist gut verwertbar. Sorbit, ein Zuckeraustauschstoff, der in vielen Süßwaren enthalten ist, reduziert die Ausnutzung von Calcium und löst bei manchen Menschen Bauchkrämpfe und Durchfälle aus. Für den Körper ist Calcium in organischer Form wesentlich besser verwertbar als in anorganischer Form. Zu den besser verwertbaren organischen Calciumverbindungen in Nahrungsergänzungsmitteln zählen beispielsweise Calciumgluconat, Calciumaspartat, Calciumcitrat und Calcium Chelat. Häufig werden Calciumcarbonat, ‑lactat oder ‑gluconat verwendet, deren Resorptionsrate bei circa 30 Prozent liegt. Besonders ältere Menschen haben bei ungenügender Magensäurebildung Schwierigkeiten mit der Aufnahme von anorganischen Kalziumverbindungen.
2500 mg Calcium pro Tag werden von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für Erwachsene als tolerierbare Gesamtzufuhrmenge angesehen. Wenn über Lebensmittel und Präparate regelmäßig mehr als 2500 mg Calcium zugeführt werden, steigt das Risiko für schädliche Nebenwirkungen durch eine Überversorgung.
Calcium Überdosierung
Die Zufuhr von Nahrungsergänzungsmitteln kann nicht nur positives bewirken, sondern auch zu einer Überversorgung führen. Eine überhöhte Calciumzufuhr verschlechtert die Aufnahme von Eisen, Zink und Magnesium und kann eine Unterversorgung dieser wichtigen Nährstoffe zur Folge haben. Langfristig kann eine erhöhte Calciumkonzentration im Blut zu Harnsteinen und einer gestörten Nierenfunktion führen. Es besteht sogar der Verdacht, dass eine erhöhte Zufuhr von Calcium über Nährstoffpräparate das Risiko für Herzkrankheit und Prostatakrebs beeinflussen könnte.
Mögliche Anzeichen einer Calciumüberversorgung können beispielsweise Appetitlosigkeit, Leistungsabfall, Übelkeit, Muskelschwäche, Erbrechen, Verstopfung, Lähmungserscheinungen, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck und Müdigkeit sein. Wenn die Hypokalzämie entgleist, kann es zur hyperkalzämischen Krise kommen, die im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein kann. Die Folgen können Bewusstseinsstörungen, Dehydration und Koma sein.
Fazit
Wer von Kindheit an ausreichend Calcium zu sich nimmt, mineralisiert seine Knochen optimal. Nach dem 30. Lebensjahr wird kein zusätzliches Calcium mehr eingebaut. Viel Bewegung im Freien, sodass gleich auch Vitamin D gebildet werden kann, ist deshalb ebenso wichtig wie eine ausreichende Calciumzufuhr. Durch eine zu geringe körperliche Aktivität wird außerdem Osteoporose gefördert.
In der Regel nehmen wir genügend Calcium durch die Nahrung auf und können auf Nahrungsergänzungsmittel verzichten. Besteht jedoch der Verdacht auf einen Calciummangel, sollte dieser zeitnah beim Arzt überprüft werden, denn ein Mangel an Calcium kann weitaus gravierendere Folgen haben, als man denkt. Calcium ist eben doch mehr als nur ein Mineralstoff, der in unseren Zähnen und Knochen enthalten ist.